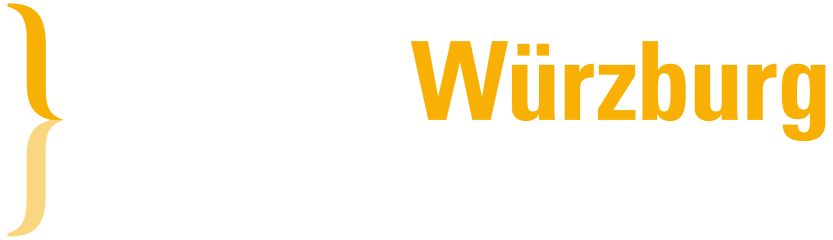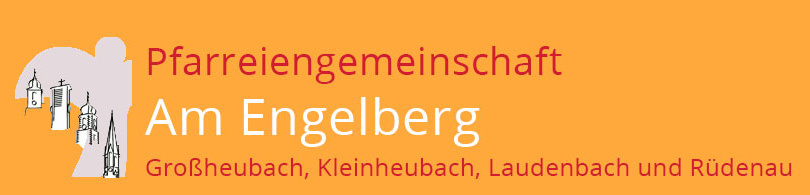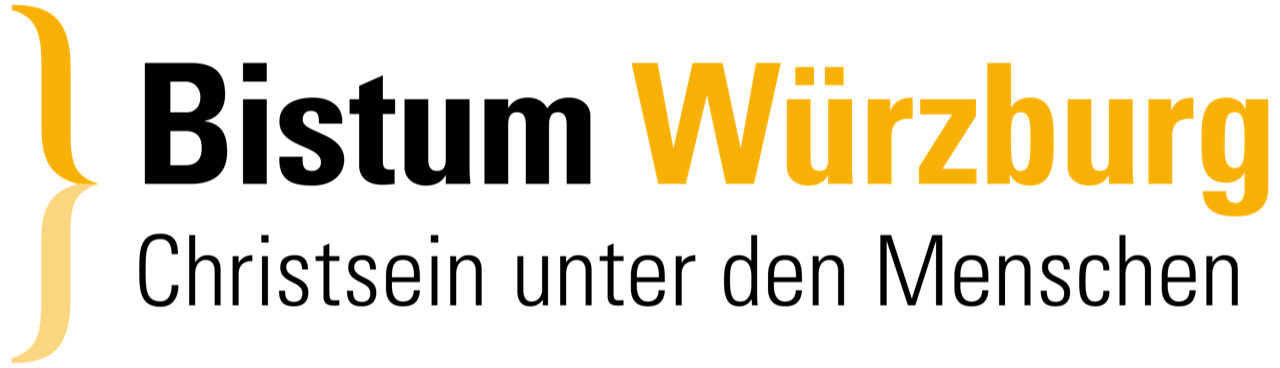Das erste Siegel unserer im Jahre 1821 gegründeten Pfarrei nannte nicht das Patrozinium unserer Kirche. Es trug in Großbuchstaben die Aufschrift "KÖNIGL. BAYER. PFARRAMT RÜDENAU" und das damalige bayerische Wappen.
Die hl. Othilia wird im Realschematismus der Diöcese Würzburg 1897 als Patronin der Pfarrkirche Rüdenau genannt. Deshalb werde die Kirche "von Augenleidenden der Umgebung zur Verehrung besucht". Gemäß einem Beschluß der Gemeindeversammlung vom 04. Dezember 1912 wird der Ottilientag von da an festlich begangen. Die Statuen der drei Heiligen, die gemeinsam am 13. Dezember ihren Festtag haben, sind in unserer Kirche am linken Nebenaltar, dem Ottilienaltar, zu sehen. Dementsprechend ist das Patrozinium unserer Kirche am 13. Dezember.
Aus den oben genannten Jahreszahlen ist zu ersehen, dass Jahrhunderte vor dem Entstehen einer Rüdenauer Pfarrei bereits die Geschichte einer christlichen Glaubensgemeinde in Rüdenau begonnen hatte. Während dieser Zeit war Rüdenau nacheinander mehreren Kirchen und Pfarreien zugeordnet.
Eine frühe Kirche für die umliegenden Siedlungen